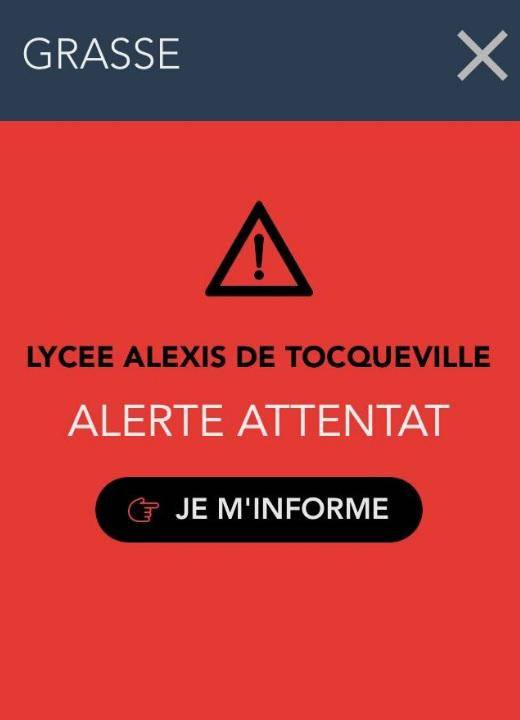Unter Waffenfreunden
Nelson · In den USA streiten Waffengegner und -befürworter über den Umgang mit Schusswaffen. Im Bundesstaat Georgia haben die Kommunen ganz eigene Ansichten zu diesem Thema, wie die Beispiele der beiden Dörfer Nelson und Kennesaw belegen. Dort sind Pistolen oder Gewehre sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Nelson. Jackie Jarrett empfängt in einem Museum, einer Sammlung all dessen, worauf Nelson stolz sein kann. Nelson, Georgia, ein Dorf mit knapp tausendfünfhundert Einwohnern, war einmal Amerikas Marmormetropole. Gerahmte Zeitungsausschnitte an den Wänden erzählen Geschichten von früher, als die kostbaren Blöcke aus dem Long Swamp Valley nach Washington gekarrt wurden, um hauptstädtische Prachtbauten zu zieren, das Kapitol, die Notenbank, das Memorial Abraham Lincolns.
Die Zeiten sind lange vorbei, die Georgia Marble Company ist nur noch ein Schatten einstiger Größe, Nelson aus anderen Gründen in die Schlagzeilen geraten. Wegen eines Revolver-Erlasses. Hier darf nicht nur jeder bewaffnet sein, er muss es sogar.Verbrecher abschrecken
Im örtlichen Gesetzbuch heißt es, dass "mit dem Ziel, die Sicherheit und allgemeine Wohlfahrt der Stadt (sic!) und ihrer Bewohner aufrechtzuerhalten, jeder Vorstand eines Haushalts eine Schusswaffe samt Munition zu besitzen hat".
"Es geht darum, Kriminelle abzuschrecken", sagt Thad Thacker, der Jarrett Gesellschaft leistet in der Museumsbaracke, die zugleich als Versammlungsraum für den Gemeinderat dient. "Die schweren Jungs wissen jetzt, in Nelson hat jeder eine Kanone, in Nelson versuchen wir es erst gar nicht." Thacker trägt einen eisgrauen Walrossbart, was seinem Gesicht etwas Verwegenes gibt, und eine marineblaue Baseballkappe, die ihn als Vietnamveteran der Navy ausweist. Jarrett, ehemals Bauarbeiter, heute berufsunfähig und angewiesen auf Invalidenrente, kommt in Jeans und Jeanshemd daher. Die beiden nehmen sich Zeit, es passiert nicht so oft, dass sich Reporter nach Nelson verirren. "Nein, wir schicken keine Polizisten in die Häuser und checken, ob deren Bewohner auch wirklich eine Flinte haben", sagt Jarrett.
Vor einem Jahr, als die Novelle in Kraft trat, klang das noch anders. Da sollten Haushaltsvorstände tausend Dollar Strafe zahlen, falls sie sich dem Waffenzwang widersetzten. Dann verlor der fünfköpfige City Council, mit Jarrett an der Spitze, einen Rechtsstreit, der in ganz Georgia für Aufsehen sorgte. Ein gewisser Lamar Kellett, Nelsoner Urgestein, hatte 646 Dollar für den Kauf einer Pistole ausgeben müssen, dazu 32 Dollar für Patronen, um den strengen Auflagen gerecht zu werden. Dagegen klagte er, unterstützt vom Brady Center to Prevent Gun Violence, einer Initiative für strengere Schusswaffenkontrollen.
Die Verfassung, argumentierte Kellett, garantiere nicht nur das Recht auf Waffenbesitz, sie garantiere auch das Recht, keine Waffe zu tragen. Mit anderen Worten Entscheidungsfreiheit. Kellett setzte sich durch, seitdem ist der Paragraf mit der Geldbuße nur noch Makulatur.
An den Gründen für den Waffenzwang, so sieht es jedenfalls Jarrett, ändert der kleine Schönheitsfehler allerdings nichts. "Mal angenommen, wir müssen uns verteidigen. Dann bilden die Bürger von Nelson eine Miliz, so steht es ja auch in der Verfassung", philosophiert er und zählt auf, wer dem Freiwilligentrupp angehören würde: der örtliche Polizist und sechs Armeereservisten, das wäre das Kernkontingent. Gegen wen man sich verteidigen müsse? "Mal angenommen, feindliche Kräfte übernähmen die Macht", antwortet Jarrett im Verschwörerton und lässt im Nebel, welche Kräfte er meint. Eigentlich wäre es ja die Aufgabe der Nationalgarde, gegen den Feind einzuschreiten. "Aber wer befehligt die Nationalgarde? Der Präsident. Und Barack Obama traue ich nicht." Irgendwann erklärt Tacker, dass die Patrioten von Nelson im Grunde nur eine Botschaft aussenden wollten, eine Botschaft ans Weiße Haus. Als Obama nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Newtown vom Verbot von Sturmgewehren zu reden begann, "da dachten wir uns, hier muss jemand gegenhalten, sonst ist es um unsere Verfassung geschehen".
Nebenan schnarrt ein Walkie-Talkie, dort sitzt Jim Koury, der Polizeichef, ein Kleiderschrank von einem Mann. Auf dem Regal der Helm eines Football-Spielers. Ohne Umschweife erzählt Koury von den Ordnungshütern, die in neun von zehn Fällen zu spät kämen, wenn etwas passiere. "Eine Regierung, die den Leuten nicht gestattet, sich selber zu schützen, handelt fast schon kriminell", wettert der Sohn libanesischer Einwanderer. "Miss Francis hier oben in der Siedlung, die kann mit ihren 87 Jahren noch immer einen Abzug drücken. Ob Miss Francis einen Angreifer mit einem Baseballschläger niederstrecken kann, das wage ich zu bezweifeln."
Seit Juli aber hat Georgia ein neues Waffengesetz, das lockerste der Vereinigten Staaten, das selbst in Nelson gemischte Gefühle auslöst. Neuerdings darf man sein Schießeisen fast überallhin mitnehmen, in die Kneipe, die Kirche, in öffentliche Gebäude und sogar auf den Flughafen von Atlanta, einen der größten der Welt - bis zur Sicherheitsschleuse. Jarrett ist nicht wohl bei dem Gedanken. Wenn die Gemeinde tage, werde schon mal gestritten, manchmal lägen die Nerven blank, sicher. "Und nun? Du weißt nicht, wer durch diese Tür kommt", seufzt er und schaut ratlos in Richtung Barackeneingang. "Ist es jemand mit einem Revolver, musst du ihn trotzdem reinlassen." "Verrückt", sekundiert Thacker und spricht vom Wilden Westen. "Waffen am Kneipentresen? Damit sind wir in Dodge City."Kritik am Norden
Szenenwechsel. Kennesaw, sauberes, aufgeräumtes Suburbia-Milieu vor den Toren Atlantas. 1982 war Kennesaw die erste amerikanische Stadt, die ihre Bürger zum Waffenbesitz verpflichtete. Wenn Craig Graydon davon erzählt, spricht auch er von einem Zeichen, das es zu setzen galt. Morton Grove, ein Vorort Chicagos, hatte Privatwaffen im Stadtgebiet für illegal erklärt. Also wollte der Süden die Flagge des Widerstands hissen, dem liberalen Amerika im Kampf der Kulturen die konservative Stirn bieten. Graydon hat daheim zwei Pistolen im Schrank, eine Glock und eine Smith & Wesson. Sein Vater war dreißig Jahre bei der Marineinfanterie, schon als Kind lernte er schießen, wie die meisten Nachbarskinder auch. "Wissen Sie, all die Gesetze, das ändert eigentlich nichts."
Dent Myers steht hinter seiner Ladentheke wie ein gealterter Hippie aus San Francisco, mit langen, verknoteten Bartsträhnen und einem schwarzen Band um die Stirn. Nur dass in den Lederhalftern um seine Hüften zwei Pistolen stecken und ihn graue Bürgerkriegsuniformen flankieren, Militärmützen, eine Whiskeyflasche Marke Rebel Yell. "Wildman\'s Civil War Surplus", das Memorabiliengeschäft, das Myers seit 43 Jahren betreibt, versteht sich als Bastion trotziger Südstaatennostalgie. "Wenn die Yankees im Norden sagen, ihr könnt keine Waffen haben", grummelt der alte Mann, "erwidern wir hier unten, oh doch, ganz sicher können wir das".